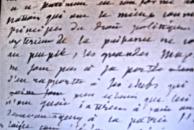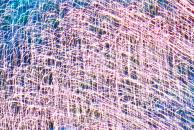AHNUNG UND ZUFALL
Teil 1

Dieser Tage habe ich wieder einmal erfahren, was der Zufall so alles bewirken kann, wenn man sich denn auf ihn einlässt. Begonnen hatte alles mit einem mysteriösen Bild, das ich zufällig in einem Stapel alter Zeitungen entdeckte, die ich draußen vor dem Haus in der Papiertonne entsorgen wollte. Wie gebannt hielt ich inne, denn schon beim ersten Blick nahm mich das Bild gefangen, ohne dass ich hätte sagen können, warum? Aber ein unbestimmbares Gefühl sagte mir, dass es mit dem Bild eine besondere Bewandtnis habe, also nahm ich es mit zurück ins Haus und legte es irgendwo ab.
Dass mich meine Ahnung nicht getrogen hatte, zeigte sich schon am nächsten Tag, als diese mich – nach einer Reihe weiterer Zufälle – behutsam in das Reich der Erinnerung hineinbewegt hatte, und mich dort eine wunderbare und unvergessliche Erfahrung machen ließ. Kein Wunder also, dass mir das Ganze auf einmal nicht mehr wie ein Zufall vorkam, denn meine Ahnung begleitete mich auf meiner inneren Reise und wies mir den Weg.
Wobei es mir immer befremdlicher erscheint, das Leben in derlei Kategorien zu unterteilen, sind doch die Grenzlinien zwischen dem Erwartbaren und dem Unerwarteten manchmal äußerst diffus. Und was ist im Leben schon wirklich erwartbar, wenn dieses im Grunde doch nichts anderem als einem Prozess voller Bewegung und Unwägbarkeit gleicht? Eine Frage, die in ihrer Brisanz dieser Tage wieder einmal drastisch zutage tritt.
Doch da der Mensch nichts so sehr hasst wie Unsicherheit, und dies in jeder Hinsicht, tendiert er dazu in allem Erlebten nach Sinn zu suchen. Aber da ihm das natürlicherweise nicht immer gelingt, nennt er Geschehnisse, die sich ohne jegliche Vorboten wie aus heiterem Himmel ereignen, kurzerhand Zufall und legt diese unter der Rubrik ABSOLUT SINNLOS in seinem Hinterstübchen ab.
Doch das Nichtvorhersehbare ist immer auch das Überraschende, die unerwartete Konfrontation mit Neuem und Unbekanntem – ein Phänomen, das dem Leben mit seinen Höhen und Tiefen ja erst die eigentliche Würze verleiht. Dabei sind es vor allem die zufälligen Ereignisse, die dem Leben seine fantastische Vielgestaltigkeit verleihen. Ohne Tiefpunkte gäbe es auch keine Höhenflüge. Der Dirigent Otto Klemperer, der zeitlebens an einer Bipolaren Störung litt, antwortete einmal auf die Frage, was diese Erkrankung für ihn bedeute, er sehe vor allem in seinen depressiven Phasen nicht nur das Leid, sondern vor allem auch die tiefen Erfahrungen, die diese ihm hätte zuteilwerden lassen. Weitreichende Erfahrungen, die er zu den Wichtigsten seines Lebens zähle.
Von der Nacht ins Licht: Wie hasenfüßig es doch ist, dem Leben die ihm eigenen Oszillationen nehmen zu wollen, indem man es kleinmütig versucht, es zeitlebens streng am Zügel zu halten, und dessen schier unvorstellbares Erfahrungspotenzial, das dieses offeriert, möglichst zu umschiffen. Doch das Leben kennt auch glückliche Zufälle, die, wenn man sie denn beim Schopfe packt, immer wieder ungeahnte Räume eröffnen, von denen man vorher keine Ahnung hatte. Und diese zu betreten, kann bedeuten, Erfahrungen zu machen, die man als innere Wegweiser sein Leben lang nicht mehr vergisst.
Mich auf eingetretenen Pfaden zu bewegen, war noch nie so meine Sache. Das kann manchmal sogar auch dazu führen, dass ich den Zufall förmlich zu provozieren versuche, um mich von diesem lustvoll herausfordern zu lassen. Selbst wenn es schiefgehen sollte, gehört das Scheitern doch auch zum Dasein. Neue Lebensräume zu entdecken ist mir einfach wesentlich wichtiger als das alltägliche, sich abschottende Einerlei, das auf Dauer träge macht und den Lebenshorizont auf die Dimension eines Vorgartens zusammenschrumpfen lässt.
Derart abenteuerliche Unternehmungen erfordern jedoch auch eine gehörige Portion Mut, der mich glücklicherweise bislang noch nie verlassen hat. Und da mich darüber hinaus auch keine Existenzängste plagen, obwohl ich einige Male finanziell praktisch vor dem Nichts stand, habe ich auch keine Angst vor nicht absehbaren, alles auf den Kopf stellenden Veränderungen, die mich möglicherweise beuteln und auf die Probe stellen könnten. In solch krisenhaften Situationen krempelte ich bislang ohne groß nachzudenken die Ärmel hoch und nahm auf die Schnelle irgendeinen Gelegenheitsjob an, der mir über das Gröbste erst einmal hinweghalf. Wenn man glaubt, sich für etwas zu schade zu sein, hat man schon ein gehöriges Problem am Hals, das man mit sich durchs Leben schleppt.
In diesem Sinne war ich bislang wohl für jede Überraschung gut, wie man salopp sagen würde. Und wenn mir einmal etwas richtig gelungen war, konnte jeder, der es wollte, mich sagen hören, der Zufall sei eben der beste Koch. Und darüber hinaus spielten zufällige Ereignisse schon immer eine große Rolle in meinem Leben, das ist mir durchaus bewusst, ob sie mich nun auf meinem Weg zurückwarfen oder mir plötzlich neue Perspektiven eröffneten. Mag der Zufall auch manchmal rätselhaft erscheinen, den Impuls zur Verwandlung trägt er immer in sich.
Im Leben hingegen nur auf das Erwartbare zu setzen heißt, sich klammheimlich hinter seinen Gewohnheitsritualen verstecken zu wollen. Doch auch derart trügerische Existenzblasen können jederzeit zerplatzen, steht die Bewegung des Lebens doch niemals still – ein scheinbar immerwährender Prozess der Veränderung und Verwandlung, der einen aber auch schon einmal in die eiskalten Regionen der menschlichen Existenz abrutschen lässt, ohne dass man es vorausgesehen oder geahnt hat.
Der Idealfall des Zufalls ist es, wenn ich lange auf einer Parkbank in irgendeiner belebten Parkanlage irgendeiner Großstadt verweile, nichts groß denke, aber mit intuitiver Neugier die Menschen um mich herum betrachte. Bis sich dann irgendwann (rein zufällig) eine wildfremde Person neben mich auf die Bank niedersetzt, mit der ich – ohne erkennbaren Anlass oder ersichtlichen Grund – bald tief ins Gespräch komme und wir uns beide von Dingen erzählen, die wir zuvor noch niemandem erzählten. Herzensgeheimnisse, die wir auch deshalb offenbaren, weil wir wissen, dass wir uns nie wiedersehen. Was wir uns gegenseitig dann auch eingestehen – erstaunten Herzens und voller Verwunderung lachend.
Die polyvalente Potenzialität des Zufalls liegt in dessen stets überraschenden und nicht kalkulierbaren Charakter begründet, der damit dem letztlich völlig unberechenbaren Prozess des Lebendigen viel entsprechender erscheint als eine ausgebremste Existenz, die sich in sturer Überschaubarkeit und geistlosem Stillstand erschöpft. Derart steife Charaktere hassen von Natur aus den Zufall wie die Pest, da dieser – allein schon in deren Vorstellung – nur Dunkles mit sich bringen kann. Verbogene, völlig lebensferne Haltungen, die angesichts des Lebendigen, das praktisch alles dem Zufall zu verdanken hat, nachgerade tragische Züge trägt: Ob Hai oder Mensch – die Evolution besteht nun einmal aus einer Kette unwahrscheinlicher Ereignisse, die einem unermesslichen Meer von Möglichkeiten entspringen und sich im Wesentlichen rein zufällig ereignen.
Hätte nicht ein Asteroid am Ende der Kreidezeit, also vor etwa 65 Millionen Jahren, die Dinosaurier, die das Ökosystem an Land über 150 Millionen Jahre lang dominierten, rein zufällig von der Erde gefegt, hätten sich die Säugetiere, die damals als winzige Wesen im Schatten der Dinosaurier kaum eine Chance hatten, sich wohl nie bis hin zum Menschen entwickeln können, der heutzutage zwar nun seinerseits die Erde dominiert, aber dennoch eines Tages ein ähnliches Schicksal wie die Dinosaurier erleiden könnte. Dies allerdings nicht unbedingt aufgrund eines Asteroiden, sondern einzig und allein nur deshalb, weil er mit sich selbst nicht zurechtkommt.
In diesem Kontext ist es erhellend, daran zu erinnern, dass sich der Begriff des Zufalls vom lateinischen accidens ableitet, was so viel wie Unfall bedeutet. Ein plötzliches und schlimmes Ereignis also, dass das Leben nicht nur gefährden, sondern darüber hinaus auch jäh zerstören kann. Insofern birgt die abgründige Angst vor Bewegung und Veränderung auch immer die vor dem bösen Zufall in sich – eine völlig irrationale Angst, die allerdings mit der vor dem Tod eng verschwistert scheint, da dieser jedwedes Lebewesen ja auch aus purem Zufall mit sich zu reißen vermag: So liegt letztlich also auch der Tod zumeist in den Händen zufälliger Vorkommnisses, die abzuwehren deshalb auch immer einer völlig absurden und manchmal sogar tragisch-komischen Unternehmung gleicht, kommt der Tod doch, wann immer er will.
Diese gnadenlose existentielle Unsicherheit halten viele Menschen schon im Ansatz nicht aus, treten panikartig die Flucht nach vorne an und behaupten, dass das Leben gar keine Zufälle kenne, wäre alles Geschehen doch vorherbestimmt und dem Schicksal unterworfen. Dabei stellt sich jedoch sofort die Frage, wer solch ein allgemeinverbindliches Lebensprogramm denn eigentlich entworfen und festgelegt haben sollte? Eine höhere Macht, lautet die Antwort. Auch heutzutage noch. Gott kommt allerdings nicht mehr vor. Der ist ja längst tot!
Doch wie immer dem auch sei, mit der deterministischen Vorstellung eines von vorneherein präformierten Lebensablaufs erhält auch der Zufall einen, wenn auch übergeordneten Sinn, der sich so in Form einer notwendigen Faktizität gleichsam nahtlos in die Kette aller angeblich von vorneherein festgelegten Lebensereignisse einreihen würde. Dessen eigentlicher Sinn müsse dem Menschen allerdings verborgen bleiben, da er ja Ausdruck des Schicksals und damit des Numinosen sei.
Eine schwindelerregende Vorstellung! Denn das hieße ja, dass der Mensch unter solchen Umständen seinen freien Willen vergessen könnte, wäre er dann doch nichts anderes mehr, als der besinnungslose Erfüllungsgehilfe seines eigenen Schicksalsplans, den eine ominöse Macht für ihn festgelegt hätte, damit er sich an diesem eben abarbeite. Wie drastischerweise Sisyphos, der mir sofort in den Sinn kommt, wenn ich an all die Verstiegenheit denke, die in einem solch menschenverachtenden Weltbild steckt. Denn dann könnte man auch des Menschen Verantwortungsbewusstsein glatt vergessen.
Aber auf all diese altbekannten Fragen gab schon der aus grauer Vorzeit stammende Mythos von Ödipus, dem König von Theben, die wohl entscheidende Antwort. Besagt dieser doch, dass es dem Menschen – selbst unter der Voraussetzung, es gäbe so etwas wie ein Schicksal – ganz unabhängig davon immer obläge, sein Verhalten entsprechend zu zügeln. So besäße dieser zwar einen freien Willen, aber auch diesem seien deutliche Schranken gesetzt – durch Recht und Ordnung nämlich. Diejenigen aber, die glaubten, sich darüber hinwegsetzen oder erheben zu können, ergriffe die göttliche Schicksalsmacht und bestrafe diese mit Fluch, Verachtung und selbsterwähltem Tod – so die Botschaft der Geschichte. Und selbst derjenige, der glaube, sein Schicksal zu kennen und deshalb alles daransetze, um diesem zu entgehen, würde sich währenddessen doch nur in seinen eigenen Taten derart verstricken, dass man vermeinen könne, dieser hätte sein Schicksal selbst erfüllt. So eben, wie dies auch Ödipus tat.
Dieser hatte nämlich seinen Vater Laios erschlagen und seine Mutter Iokaste geheiratet, mit der er vier Kinder zeugte. Dies alles jedoch völlig unwissentlich, denn jetzt ist er König von Theben und herrscht mit uneingeschränkter Macht. Als dort aber eine schwere Seuche ausbricht und man das Orakel verzweifelt befragt, was denn zu tun sei, damit die Seuche ende, antwortet dieses lapidar, der Mörder des Laios müsse gefunden werden.
Unverzüglich macht sich König Ödipus daran, den Mörder aufzuspüren und findet ihn schließlich – sich selbst, den Täter, der einst im Jähzorn einen Mann erschlug, von dem er nicht wusste, wer er ist – nur weil dieser ihm mit seinem Karren im Wege stand und an der Weiterfahrt hinderte. Ob er nun seinen eigenen Vater erschlug oder nicht – Ödipus ist schuldig. So der so. Der König fällt tief und blendet sich selbst, als er seine Frau und Mutter Iokaste am Strick hängen sieht, die sich ob allem erhängte.
In all diesem Geschehen Ödipus als Vollstrecker seines eigenen Schicksals erkennen zu wollen ist so trügerisch wie der Schicksalsbegriff selbst. Denn auch ein König, der glaubt, mit seiner Mordtat ungeschoren davonzukommen, kann sich der göttlichen Rache nicht entziehen, ob diese nun prophezeit wurde oder nicht. In Wahrheit aber ist es die Hybris des Königs – dessen Übermut und Selbstüberschätzung, weswegen er von der Nemesis ein solch fürchterliches Schicksal erfährt.
Doch auch die griechischen Götter haben sich längst in Luft aufgelöst, wie ja auch der christliche Gott, der es übrigens ebenfalls nicht vermochte, den Menschen zu besänftigen und ihn zur Umkehr zu bewegen. Seitdem ist dieser allein in der Welt und bereits im Begriff, nicht nur sich selbst, sondern auch das Erdenrund zugrunde zu richten.
Wenn es trotz allem aber dennoch so etwas wie Schicksal gäbe, fände man dieses beispielsweise in der Charakterstarre so mancher Zeitgenossen wieder, die aufgrund ihrer verbohrten Hartnäckigkeit gar nicht anders können, als sich immer wieder nur auf dieselbe stereotype und sture Art und Weise verhalten zu können. Gefangen in einem engbegrenzten und rigiden Verhaltensrepertoire, mit dem diese den Anschein erwecken, als würden sie lediglich ein vorprogrammiertes Leben abspulen, was nach außen so wirken kann, als wäre es deren Schicksal. Doch in Wahrheit liegt der Grund eines solchen Verhaltens nicht in irgendeinem Schicksalsplan verborgen, sondern einzig und allein im halsstarren Wesen dieser Menschen selbst. Jammergestalten allesamt, die hinsichtlich der Frage, warum es dem Menschen denn so schwerfalle, in Freiheit zu leben, nachgerade schon als Ikonen der Unfreiheit fungieren könnten.
Ein Leben, das sich solcherart selbst auf den Leim geht, war mir schon immer ein Gräuel, vor dem mich vor allem die Gabe zur schonungslosen Selbstkritik und eine Handvoll guter Freunde zu schützen wussten. Doch die Überzeugung, mich dem Strom der Dinge anvertrauen zu können, fällt mir, ehrlich gesagt, zunehmend immer schwerer: Fließt dieser Strom doch gegenwärtig in die absolut falsche Richtung. In dieser fatalen Situation jedoch immer noch auf die Hoffnung zu bauen, gelingt mir nur, weil ich felsenfest an den Zufall glaube – an einen glücklichen natürlich.
ENDE VON TEIL 1